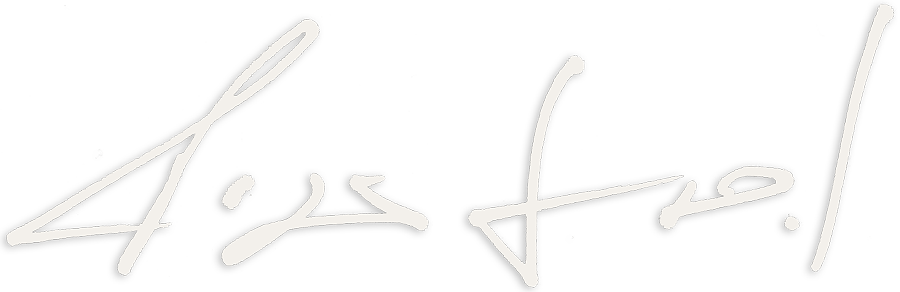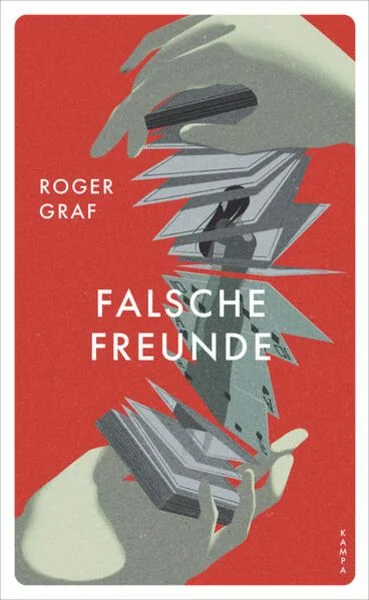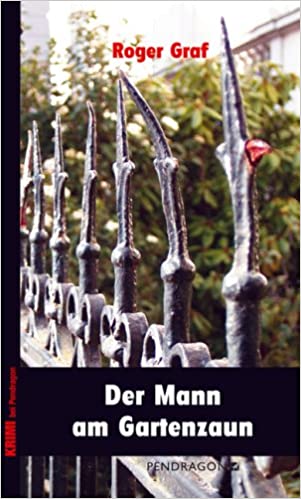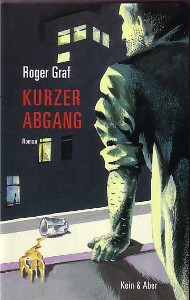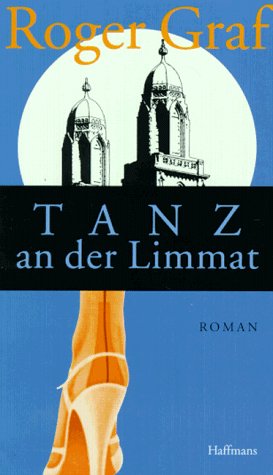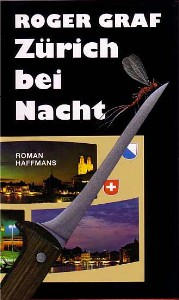Klappentext
In einem Waldstück in der Nähe von Zürich wird ein junger Bankangestellter ermordet aufgefunden. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Als einziges Indiz dient der Fahndungsgruppe eine Plastikuhr, die der Täter an beiden Tatorten zurückgelassen hat, eingestellt auf 11 Uhr 15. Eine Mitteilung vom Täter? Aber wie ist sie zu deuten?
Auszug
Kapitel 1
Die Vögel trillerten den Tag ein, und selbst die alte Buche am Wegrand schien ein wenig zu strahlen, als er lockeren Schrittes an ihr vorbeiging. Bei der Parkbank blieb er wie immer stehen und machte ein paar Dehnübungen. Nichts deutete darauf hin, daß er an diesem Morgen dem Tod begegnen würde. Hätte man ihn gefragt, er hätte sich in diesem Augenblick für unsterblich gehalten. Erfolgreich im Beruf, verheiratet, Vater einer fünfjährigen Tochter, keine vierzig und schon ein Eigenheim im Grünen. Den Kopf voller Pläne und der Körper athletisch und gesund. Mir geht es gut, dachte er. Einen Satz, den er in Gedanken oft wiederholte, weil er gelesen hatte, daß erfolgreiche Menschen ständig solche Sätze im Kopf haben. Ich schaffe es. Ich bin der Größte. Mir geht es gut. Er hob seinen Kopf und hielt ihn der Sonne entgegen. Noch war die Strahlung schwach, doch es tat gut, die echte Sonne zu spüren, nachdem er wochenlang hatte mit der Höhensonne vorliebnehmen müssen. Trübe, kühle und regnerische Wochen. Ein Frühling, der noch im Winterkleid steckte. Nächsten Winter fliegen wir zwei Wochen in die Karibik, dachte er. Das half sicherlich auch gegen die Gemütsschwankungen seiner Frau, die einen unzufriedenen Eindruck machte und manchmal überfordert schien, wenn die Tochter sich stur stellte. Er schaute auf seine Armbanduhr und drückte den Knopf, der die Stoppuhrfunktion startete. Er wollte es langsam angehen an diesem Morgen, das Tempo kontinuierlich steigern und schließlich mit einem Schlußpurt seine bisherige Bestzeit unterbieten. Ich schaffe es, dachte er und begann loszulaufen.
Die Turmuhr schlug siebenmal, als Frau Bannwart ihren Nachbarn zum letztenmal lebend sah. Wie immer winkte er ihr zu, und wie immer bellte Frau Bannwarts Hund zweimal laut, bevor sie ihn durch ein ruckartiges Ziehen an der Leine zum Verstummen brachte. Ein herrlicher Tag, dachte sie und ging in Gedanken die Besorgungen durch, die sie für das Abendessen benötigte. Vier Gänge wollte sie kochen und damit ihrem Mann den Abend mit ihren Eltern schmackhaft machen. »Ausgerechnet heute«, hatte er ihr beim Frühstück vorwurfsvoll gesagt und ihr dazu den Sportteil der Tageszeitung unter die Nase gehalten. »Soll ich mein ganzes Leben nach dem Sportteil der Zeitung ausrichten«, hatte sie ihm entgegnet, worauf er nur mit einem Grunzlaut antwortete. Ihr Hund zog an der Leine und beschnupperte die Gräser. Ein Glück, daß sich Hunde nicht für Fußballspiele interessierten. Sie hielt eine Hand an die Stirn, weil die Sonne sie blendete. Einen Moment dachte sie, eine Gestalt zu sehen, die sich am Waldrand hinter einem Baum zu verstecken schien. Als sie aber beim zweiten Hinsehen nichts erkennen konnte, wandte sie sich ab, denn ihr Hund schien an diesem herrlichen Tag eine andere Route zu bevorzugen. Sie sah, wie ihr Nachbar zum Aussichtspunkt hochrannte, und sie dankte in Gedanken dem Herrgott für den herrlichen Tag.
Schon nach wenigen hundert Metern spürte er den Stich im Oberschenkel. Er fluchte und verlangsamte sein Tempo zu einem leichten Traben. Der Schmerz ging weg, doch sobald er beschleunigte, stach es in der Muskulatur. Mist, dachte er, hoffentlich keine Zerrung. Er blieb stehen und massierte den Muskel. Ausgerechnet an einem solch schönen Morgen. Wochenlang war er bei bitterer Kälte oder durch Nieselregen gerannt, ohne daß dies seinen Muskeln etwas anhaben konnte. Und jetzt, als endlich wieder die Sonne schien, kam der Schmerz. Er haßte Schmerzen. Er haßte es, nicht vollständig fit zu sein. Beim kleinsten Anflug von Kopfschmerzen schluckte er drei Schmerztabletten, zuviel, wie ihm seine Frau vorhielt, aber der Schmerz ging rasch weg. Am liebsten wäre er umgekehrt und hätte sich zu Hause mit einer Salbe den Muskel eingerieben, doch etwas hielt ihn zurück. War es sein Ehrgeiz, war es die Sonne oder war es sein Schicksal, das ihn am Waldrand erwartete? Es gab keinen Grund, mit schmerzendem Muskel weiterzurennen, und trotzdem tat er es.
Er schaute sich um und sah Frau Bannwart, die mit ihrem Hund auf dem schmalen Feldweg ging, den er nicht mochte, weil er mit kleineren und größeren Steinen gespickt war. Er ging zum Startpunkt zurück und stellte seine Stoppuhr neu ein. Verhalten rannte er los. Als er den am Wegrand geparkten Wohnwagen passierte, schmerzte der Muskel nicht mehr. Na also, dachte er. Alles entscheidet sich im Kopf. Jetzt lief er in jenem gleichmäßigen Trab, der alle Gedanken verdrängte. Die Landschaft zog wie eine Diaschau an ihm vorbei, und die Geräusche entfernten sich, bis er nur noch seinen Atem und seinen Herzschlag zu hören schien. Ja, seinen Herzschlag, auch wenn das nur Einbildung war. Er lief wie eine perfekt geölte Maschine, gleichmäßig und fast von selbst. Ganz auf sich selbst konzentriert, rannte er die Stufen hinauf, die in die Feuerstelle und den Aussichtspunkt mündeten, den Spaziergänger sonntags bevölkerten, weil er einen schönen Rundblick bot. Steil ging es bergan, kurz nur, aber heftig. Seine Muskeln übersäuerten, sein Atem wurde kürzer. Als er die Parkbank sah, wußte er, daß er es geschafft hatte. Der schwierigste Teil lag hinter ihm, jetzt konnte er sich auf die Schlußphase konzentrieren. Er wagte einen Blick auf die Uhr und sah, daß er gut unterwegs war. Ich schaffe es, dachte er. Nichts konnte ihn aufhalten. Dachte er. Als er die ersten Bäume des Waldes passierte, fröstelte ihn ein wenig. Die Bewegung nahm er zuerst ganz instinktiv war. Ein Tier, dachte er, doch dann sah er die Gestalt, die sich ihm in den Weg stellte. Er lächelte unsicher und versuchte auszuweichen, ein Grußwort auf den Lippen. Da traf ihn auch schon der erste Schlag.
Kapitel 2
Damian Stauffer schlürfte eine Tasse Kaffee und schaute zufrieden aus dem kleinen Büro. Nach mehreren Wochen aufreibender Diskussionen, Eingaben und unzähligen Sitzungen hatte er erreicht, was ihm schon seit Jahren vorschwebte, was aber wegen bürokratischer Hindernisse lange unmöglich schien. Er war der Chef der neuen Ermittlungsgruppe Kapitalverbrechen, die bei Tötungsdelikten zum Einsatz kam. Er war direkt der Staatsanwaltschaft unterstellt, und er konnte sich seine Truppe selber zusammenstellen. Bei dem Gedanken mußte er schmunzeln. Freiwillig hatte er zwei Kollegen in die Gruppe geholt, die als schwierig galten, kaum teamfähig und deshalb im Kriminalkommissariat nicht sehr beliebt waren. Urs Holzer, 55 Jahre alt, ein knorriger Geselle, meist schlecht gelaunt und mit schlechten Manieren, was vor allem einige junge Polizistinnen bemängelten, die Holzer unverhohlen einen Sexisten nannten. Stauffer hatte einige Male mit Holzer zusammengearbeitet und diesen als zwar schwierigen, aber guten Polizisten kennengelernt, der wenig sagte, aber oft die richtigen Fragen stellte. Holzer war in den Innendienst versetzt worden, was den persönlichen Umgang nicht erleichterte. Zuletzt hatte es sogar Stimmen gegeben, die ihm eine vorzeitige Pensionierung nahelegten, was Holzer aber kategorisch ablehnte. Stauffer wußte, warum. Holzer gehörte zu den Menschen, für die Arbeit alles war, was im Leben zählte. Je mehr man ihn forderte, um so besser wurde er. Doch weil man ihn zuletzt kaum noch forderte, galt er als schlechter Polizist.
Ganz ähnlich und doch völlig verschieden waren die Gründe, weshalb Lukas Bolliger im Polizeikorps unbeliebt war. Ein junger Draufgänger, der oft schneller handelte als dachte und der deshalb schon einige Disziplinarverfahren am Hals hatte. Stauffer hatte bislang erst einmal mit Bolliger zusammengearbeitet. Dabei war er ihm als übereifriger Polizist aufgefallen, der ständig unter Druck zu stehen schien. Ein Mann, der nicht stillsitzen konnte. Stauffer wußte, worauf er sich einließ. Holzer und Bolliger waren beide Außenseiter, was aber noch schwerer wog, war die Tatsache, daß sie sich gegenseitig nicht ausstehen konnten. Als er ihnen eröffnete, daß er sie beide in seiner Truppe haben wollte, hatten sie ihn angestarrt und einige Sekunden kein Wort herausgebracht. »Von jetzt an seid ihr Kollegen«, hatte Stauffer ihnen gesagt. »Freunde müßt ihr nicht werden, aber zusammenarbeiten müßt ihr.« Er wußte nicht, ob die Zusammenarbeit funktionieren würde. Die Praxis wird es weisen, dachte er und öffnete die Schubladen seines Schreibtisches. Bis auf die oberste waren alle leer. Es ist wie ein Neuanfang, dachte er. Die kleinsten Büros auf der Hauptwache und die beiden schwierigsten Charaktere des gesamten Polizeikorps unter seinen Fittichen. Wie einfach es doch manchmal war, Skeptiker zu überzeugen.
Stauffer stand auf und ging zur Ablage. Ein Dutzend Ordner stand nebeneinander, jeder mit einer Nummer und einer Jahreszahl versehen. Ungelöste Tötungsdelikte. Zwei davon hatten sich vor bald 16 Jahren ereignet. Vier Jahre noch bis zur Verjährung. Vier Jahre, und die Täter kamen ungeschoren davon. Es gab nicht viele Staaten, in denen Tötungsdelikte verjährten. Die Schweiz gehörte dazu. Es war eines jener Gesetze, die Damian Stauffer sofort geändert hätte. Doch er war kein Politiker, und er wollte auch nie einer werden. Er strich mit der Hand über die Ordner. Zu jedem gehörten noch mindestens zwanzig weitere, gelagert irgendwo im Keller. Er wußte, daß man ihn und seine Leute daran messen würde, ob ihnen die Aufklärung zumindest eines ungelösten Tötungsdeliktes gelingen würde. In diesem Jahr noch, so rasch wie möglich. Dies konnte einige der Privilegien rechtfertigen, die seine Leute genossen. Wenig Bürokram, keine eigentlichen Dienstpläne und finanzielle Mittel, die zwar nicht üppig waren, aber ausreichend, um Kollegen neidisch zu machen. Doch was hieß das schon? Neid hatte ihn stets auf seinem Weg begleitet. Wo kein Neid ist, ist kein Erfolg. Und erfolgreich war er, das bestritt niemand.
Er ging zum Fenster und schaute in den Hof. Die Sonne beleuchtete die Wagen, und eine Polizistin schaute zu ihm hoch und winkte ihm zu. Tanja Locher, die ab sofort seine engste Mitarbeiterin war. Zusammen mit Walter Wenger und ihm bildeten sie den inneren Kern der Gruppe. Beide kannte er gut, und auf beide konnte er sich verlassen. Dazu kamen Anna Herold, eine junge ehrgeizige Polizistin, und Manuele Fontini, ein Computerspezialist und technikverrückter Tüftler, der als einziger auf der Hauptwache in der Lage war, einen abgestürzten Computer wieder zum Laufen zu bringen und in verständlichen Worten zu erklären, was für ein Problem den Absturz verursacht hatte. Stauffer schaute auf die Uhr. Es war kurz nach acht. Er wunderte sich, daß Tanja Locher noch nicht an die Tür geklopft hatte. Er vermutete, daß sie noch in ihr altes Büro gegangen war, vielleicht auch in die Kantine. Wenger würde in einer halben Stunde kommen. Die Arbeit konnte beginnen.
Stauffer hatte sich schon zurechtgelegt, mit welchem Ordner sie beginnen würden, aber er wollte zuerst hören, was Locher und Wenger dazu sagten. Stauffer hatte sich ganz bewußt den Samstag ausgesucht als ersten offiziellen Arbeitstag seiner Gruppe Kapitalverbrechen. Der Samstag war in der Regel ein ruhiger Tag auf der Hauptwache, und der Samstag war ein Symbol dafür, daß seine Gruppe neben Privilegien auch Pflichten hatte. Zu diesen Pflichten gehörte es, auch am Wochenende und nachts zu arbeiten, wenn es sein mußte. Es ging Stauffer darum, seinen Mitarbeitern zu zeigen, daß die Ordner mit den ungeklärten Tötungsdelikten genauso wichtig waren wie ein Mord, der sich am Vortag ereignet hatte. Als Tanja Locher anklopfte, räusperte sich Stauffer, bevor er sie hereinbat.
»Morgen, Chef«, sagte sie lächelnd und schaute sich im Büro um.
»Enttäuscht?« fragte Stauffer und zeigte auf die beiden Schreibtische.
»Nicht gerade luxuriös. Und wo arbeitet Walter?«
Stauffer zeigte auf die Verbindungstür.
»Noch zwei Büros, beide kleiner als dieses.«
»Wir sind also in den Abstellkammern der Hauptwache gelandet?« fragte sie und setzte sich in den Drehstuhl.
»Verbrechen werden nicht im Büro aufgeklärt«, sagte Stauffer. »Aber das weißt du ja.«
Sie nickte und schaute aus dem Fenster.
»Immerhin«, sagte sie mit dem Blick nach draußen auf den Himmel.
»Gute Fernsicht kann die Gedanken beflügeln«, sagte Stauffer lächelnd.
»Und was ist mit den Computern?«
»Kommen am Montag. Ich hoffe, du hältst es solange ohne Kartenspiel aus.«
Stauffer wußte, daß Tanja Locher leidenschaftlich gerne Patiencen legte und dies wahrscheinlich der einzige Grund war, weshalb sie ihren Computer vermißte.
»Wie lange wird es dauern, bis wir uns in einen der Fälle eingelesen haben?« fragte sie und zeigte auf die Ordner.
»Lange«, sagte Stauffer. »Aber es lohnt sich.«
»Als das geschah, war ich eine junge Polizistin.«
»Ich weiß«, sagte Stauffer.
»Und jetzt bin ich nicht mehr ganz so jung.«
»Das Leben spielt uns übel mit«, sagte Stauffer ironisch. »Der Tod aber löscht alles aus.« Der Satz kam ernster über seine Lippen, als er es gewollt hatte.
»Was ist mit Walter? Hat er verschlafen?«
»Er muß seinen Alltag anders planen als wir. Daran müssen wir uns gewöhnen.«
Walter Wenger war mit fünfzig noch einmal Vater geworden, seine Tochter war jetzt drei Jahre alt. Stauffer hatte es ihm freigestellt, deswegen auf sein Aufgebot für die Gruppe Kapitalverbrechen zu verzichten. Doch Wenger sagte sofort zu. Er war selber im Gespräch gewesen, als es darum ging, Stauffers Posten zu besetzen. Kein anderer hatte so viel Erfahrung mit Tötungsdelikten wie Walter Wenger. Wenger hatte viele der ungelösten Fälle bearbeitet, und er war mit dem Chef des wissenschaftlich-technischen Dienstes befreundet. Stauffer ging davon aus, daß viele der ungeklärten Fälle nur mit Hilfe modernster Technik und der besten Leute zu klären waren.
»Könntest du dir vorstellen, mit fünfzig noch einmal Vater zu werden?« fragte Locher und schaute Stauffer auffordernd an.
»Muß ich mir das vorstellen?« fragte Stauffer. Tanja Locher hatte eine Tochter, die bereits erwachsen war, Stauffer hatte keine Kinder.
»Das Mädchen, das vor 16 Jahren getötet wurde, hätte meine Tochter sein können«, sagte Locher und betrachtete ihre Fingernägel.
»Niemand weiß, ob sie tatsächlich getötet worden ist.«
»Niemand zweifelt daran, daß es so war.«
Stauffer nickte.
»An uns ist es, Beweise zu finden. Eine Leiche und einen Täter.«
»Wenn eine Leiche nicht gefunden wird, dann sagt das schon etwas über die Tat aus«, sagte Locher.
Ohne es auszusprechen, hatte sie damit bereits einen Hinweis gegeben, welchen der beiden alten Mordfälle sie zuerst angehen würde.
»Es ist der schwierigere Fall«, sagte Stauffer.
»Soll uns das hindern?« fragte Locher herausfordernd.
»Nein. Es sollte aber auch nicht das wichtigste Kriterium sein.«
»Ist es auch nicht.«
»Gut. Laß uns nachher darüber reden, wenn Walter da ist.«
Er schaute auf die Uhr. Stauffer hatte mit Wenger vereinbart, daß er ihn umgehend anrufen sollte, wenn er wegen des Kindes nicht wegkonnte. Tanja trommelte auf dem Schreibtisch den immer gleichen Rhythmus. Stauffer fiel der zappelige Lukas Bolliger ein. Ich muß für die beiden Baldriantabletten kaufen, dachte er. Als Stauffers Handy klingelte, schaute er zuerst auf die angezeigte Nummer. Es war nicht Wenger. Stauffer meldete sich kurz angebunden.
»Worum geht es?«
»Im Eschenwald wurde eine Leiche gefunden. Ein Mann, wahrscheinlich erschlagen.«
»Wer ist vor Ort?« fragte Stauffer und kramte einen Notizzettel aus der obersten Schreibtischschublade. Locher reichte ihm einen Filzschreiber.
»Frick.«
Stauffer kannte Frick nicht besonders gut, und es dauerte einen Moment, bis ihm dessen Vorname einfiel. Stauffer fragte nach dem genauen Leichenfundort und notierte sich die Angaben.
»Und?« fragte Locher, nachdem Stauffer das Gespräch beendet hatte.
»Vergiß das Mädchen. Wenigstens vorläufig.«
Sie begriff sofort und stand auf.
»Soll ich Wenger anrufen?« fragte sie, als sie bereits an der Tür waren.
»Ja, vom Wagen aus. Er soll auch gleich zum Eschenwald kommen.«
»Es geht also los«, sagte Locher, beinahe beschwingt.
»Sieht so aus«, sagte Stauffer ernst.
Alle Rechte beim Autor, Nachdruck und Veröffentlichung sind nicht erlaubt.