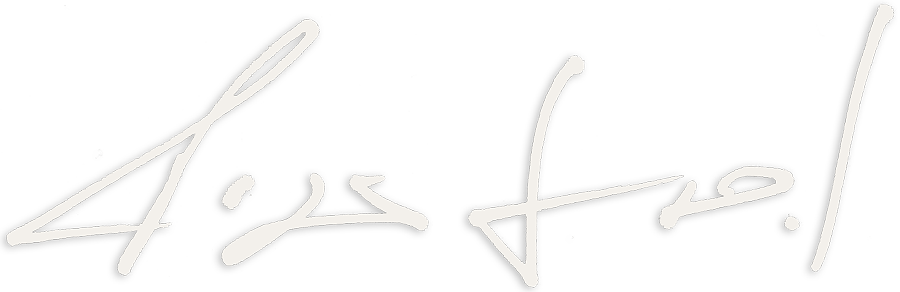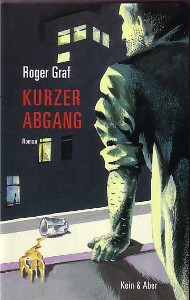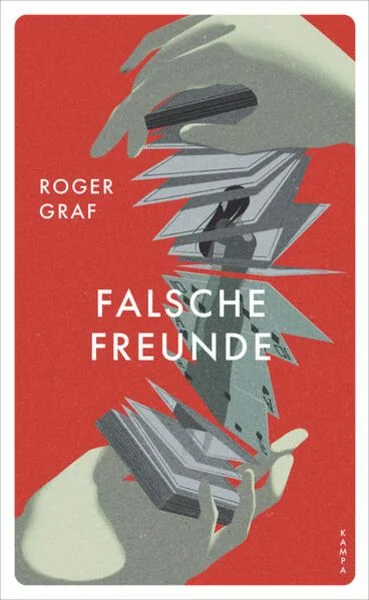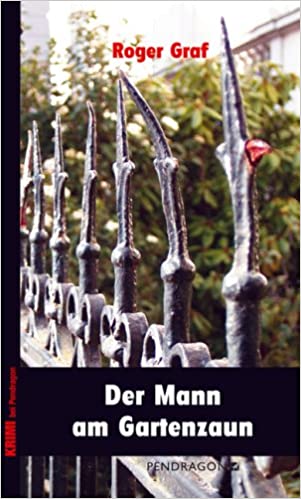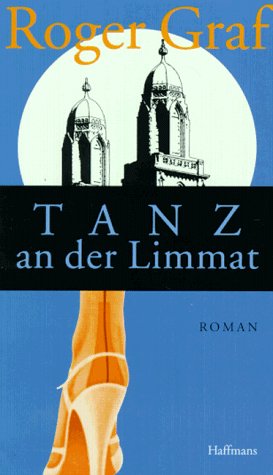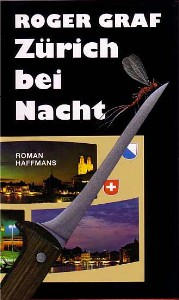Klappentext
Zurück aus Chicago erfährt ein Journalist, dass eine Frau ermordet aufgefunden wurde: Es ist die junge Fotografin, mit der er vor langer Zeit ein Wochenende verbracht hat. Dass sie kurz vor der Bluttat vergeblich seine Telefonnummer gewählt hat, wird für ihn zur Obsession. Er versucht sich in die Rolle des Opfers zu versetzen und verliert sich dabei - besessen vom Gedanken, den Atem des Mörders zu spüren - zusehends in Phantasien und im Whisky. Bis er in die Rolle des Täters schlüpft.
Auszug
Lagavulin
Seit einigen Tagen geht es mir wieder besser. Ich verbringe viele Stunden damit, aus dem Fenster zu starren. Ich sehe den Bus, der müde Passagiere ausspuckt. Einige bleiben nach dem Aussteigen einen kurzen Moment stehen, so als wüßten sie nicht so recht, weshalb sie ausgestiegen sind. Die Wartenden sehen aus wie zum Tode Verurteilte, die bereits auf den Leichenwagen warten. Natürlich kann ich mich täuschen. Aber ausgesprochen lebensfroh sieht niemand aus, der auf den Bus wartet.
Ich gebe mir keine Mühe, mich zu tarnen. Vorhänge gibt es nicht in meiner Wohnung, nur Metallrollos, die hochgezogen sind. Wer will, kann mir dabei zusehen, wie ich anderen zusehe. Mich stört das nicht. Auf dem Fensterbrett liegt eine Packung Zigaretten. Sie kommt mir fremd vor, gehört nicht zu mir, auch wenn ich sie beinahe leer geraucht habe. Zigarettenrauch stört mich jetzt wieder. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Drüben steht ein Mann neben einer Ampel und schaut in regelmäßigen Abständen auf seine Armbanduhr. Ab und zu blickt er mir hoch, ich mache ihn offenbar nervös. Ich öffne das Fenster und stütze mich auf dem Sims ab. Jetzt hat er genug und geht weg. Ruhe kann einen aus der Ruhe bringen. Ich genieße es, ruhig zu sein. Ich höre Schritte aus der Wohnung über mir, und ich rieche den Kaffee, den sich jemand in der Nachbarschaft zubereitet. Viele Fenster sind geöffnet, obwohl es kühl ist. In einer Stunde wird sich der Feierabendverkehr durch die Straße quälen. Ein träger, stinkender Wurm. Alle Leute erschrecken, wenn sie mich während der Rush-hour besuchen. Es ist unerträglich laut, und manchmal vibrieren die Fensterscheiben wegen der Lastwagen. Die Wohnung ist nicht billig, aber sie ist riesig, und das gefällt mir. Ein Zimmer steht leer, vollkommen leer. Wenn ich rede, hallen meine Worte durch den Raum. Ich rede nicht oft, wenn ich allein bin, aber wenn, dann in dem leeren Zimmer.
Der Pinguin steht jetzt an der Bushaltestelle. Er raucht einen Zigarillo. Der Rauch entweicht seinen Mund wie der Dampf einer Turbine. Der Pinguin steht jeden Tag um diese Zeit an der Bushaltestelle. Manchmal frage ich mich, ob ihn seine Freunde auch Pinguin nennen. Wenn er die Arme baumeln läßt, ein paar Schritte macht und dabei den Bauch vor sich herschiebt wie ein Eisverkäufer seinen Bauchladen, sieht er aus wie ein Pinguin. Vielleicht ahnt er es selber und trägt deshalb nie Schwarzweiß. Wäre ja noch schöner. Er wartet den übernächsten Bus ab. Das macht er ab und zu, ohne, daß ich darin ein System erkennen kann. Er steht immer zur selben Zeit da, aber er nimmt nicht immer den gleichen Bus. Vielleicht ist er in eine Busfahrerin verliebt, oder in eine Passantin. Doch er scheint sich nie umzusehen oder nach jemandem Ausschau zu halten. Der Pinguin ist eines der Rätsel, die mich beschäftigen, wenn ich aus dem Fenster schaue. Drei Stunden täglich, mindestens. Es bewahrt mich davor, nervös zu werden. Den Computer habe ich neben das Fenster gestellt. Zwei Wochen gebe ich mir. Zwei Wochen, um meine Geschichte aufzuschreiben. Es ist die Geschichte eines Mörders.
Manchmal überlege ich mir, ob sich die Menschen auf der Straße Gedanken machen, wenn sie mich sehen. Was ist das für einer, der stundenlang aus dem Fenster starrt? Für die meisten starre ich nur wenige Minuten lang, dann sind sie weg. Doch diejenigen, die mich öfter sehen, werden sich ihre Gedanken machen. Arbeitslos, armer Kerl, fauler Kerl, was auch immer. Womit sie nicht ganz unrecht haben. Vielleicht ist auch der Pinguin arbeitslos. Weshalb sollte er sonst am Nachmittag Bus fahren? Ich weiß nicht, wann er jeweils zurückkommt, sehe ihn fast nie aussteigen aus dem Bus. Egal was für Gedanken sie sich machen, die Wahrheit können sie sich nicht vorstellen, da bin ich mir sicher. Es beginnt zu regnen. Schwere Tropfen, die auf dem Fensterbrett laut aufklatschen. Wie bei einer Choreographie öffnen sich die Regenschirme. Der Pinguin hat keinen Regenschirm, er bleibt unter dem Dach des Wartehäuschens, wo sich jetzt auch andere Passagiere drängen. Eine Frau mit Schirm stellt sich ebenfalls unter. Die Straße färbt sich bunt, ein Reigen eiliger Menschen, alle mit einem Ziel vor Augen. Ich wende mich ab und schenke mir ein Glas Lagavulin ein. Jedes Wetter hat seinen eigenen Whisky. Die Gebäude, in denen dieser Malt lagert, stehen direkt am Meer. Salzwasser frißt sich in die Mauern. Die schweren Regentropfen färben sich bernsteinrot, der rauchige Abgang ist wie ein trockener Unterstand in einer nassen Landschaft. Die Tropfen verflüchtigen sich, gehen in Nieselregen über. Das war anders damals, es goß wie aus Kübeln. Ich trinke einen Schluck, die Erinnerung breitet sich aus, fließt durch meinen Körper, schließlich in die Tasten. Nach einem weiteren Schluck fühle ich mich sicher.
2. Jack Daniels
Die Maschine aus Chicago landete am Mittag. Ich hatte Kopfschmerzen und viel zu viel Gepäck dabei. Mühsam schleppte ich einen großen Koffer, der zwar mit Rädern versehen war, aber ständig umkippte. Um die Schulter trug ich eine bauchige Tasche, in der eine Flasche Jack Daniels lag, ein Single Barrel, eine amerikanische Delikatesse, auf die ich mich freute, was mir die Schlepperei einigermaßen erträglich machte. Ein bissiger Wind heulte über das Rollfeld und aus einem mir unerklärlichen Grund heftete sich ein junger Mann an meine Fersen, der mir bereits im Flugzeug unangenehm aufgefallen war. Er hatte neben einem salopp gekleideten Amerikaner gesessen, mit dem er sich auf englisch unterhielt. Den Schweizer schätzte ich auf knapp dreißig, er trug einen dieser gepflegten Dreitagebärte, wie man sie bei Bankangestellten findet, die in ihrer Freizeit gerne behaupten, gar nicht so stur zu sein wie sie aussehen. Dazu paßte die Designerbrille, deren Gestell aussah wie eine Stichwaffe. Der Amerikaner redete über die Vorzüge eines bestimmten Computersystems, das in der Bankenwelt für Furore sorgte. Während des Landeanflugs verstummte der Schweizer zusehends, faltete die Hände über seinem Aktenkoffer zusammen und starrte auf das hochgeklappte Tablett am Vordersitz. Nur einmal hob er den Blick, als eine der Hostessen die Sitzgurte kontrollierte, schaute ihr lächelnd ins Gesicht, wartete offenbar auf eine Erwiderung, die jedoch ausblieb. Dafür lachte der Ami laut auf und zeigte auf etwas, was er durch das Fenster sehen konnte. Der Schweizer nickte nur, seine Finger spielten Gymnastik, doch die Fingerkuppen berührten sich die ganze Zeit, und ich war mir sicher, daß der Kerl betete. Seinen Gesichtszügen war anzusehen, wie krampfhaft locker er sich gab, wenn er einen kurzen Seitenblick zum Ami wagte. Macht sich in die Hosen vor Angst, ist aber ständig um Würde bemüht, notierte ich mir in Gedanken. Erst als das Flugzeug aufsetzte, entspannte sich sein Gesicht. Einen Moment lang wünschte ich mir, das Flugzeug möge auf der Landebahn in Stück gerissen werden. Ich verwarf den Gedanken allerdings wieder, weil es mir nicht angebracht schien, wegen eines ängstlichen Bankers im Jenseits zu landen. Der Amerikaner wurde plötzlich ganz still, und ich dachte, daß es vielleicht so etwas wie eine Postlandedepression gab, weil mir schon öfter aufgefallen war, daß Menschen, die während des Fluges ausgelassen und fröhlich waren, nach der Landung einen ausgesprochen trübsinnigen Eindruck machten. Der Schweizer aber hatte die Angst auf seinem Sitz zurückgelassen und marschierte nun zielstrebig hinter mir her. Erst nachdem ich abrupt stehenblieb, ihn passieren ließ und dann langsam weiterging, fühlte ich mich nicht mehr von ihm bedroht. Vermutlich würde er auch beten, wenn es darum ging ein paar Tausend Leute auf die Straße zu stellen, oder seinem in die Jahre gekommenen Vorgesetzen den Dolch in den Rücken zu stoßen. Was bei der Landung klappte, konnte man auch beim Aufstieg versuchen.
Im Taxi kehrte ich Straße um Straße nach Zürich zurück. Der Taxifahrer war Grieche, sein Sohn lebte in Seattle. Er sagte, er habe Angst davor, so lange im Flugzeug zu sitzen und sei deshalb noch nie drüben gewesen. Ich erzählte ihm, daß die beiden Flüge ausgesprochen ruhig verlaufen seien und man zur Not beten könne, was aber den Flug nur unwesentlich verkürze. Darüber lachte der Grieche und schilderte mir die Begegnung mit einem Fahrgast, der ständig unverständliches Zeugs vor sich hin gemurmelt hatte. Der Grieche glaubte er habe es mit einem betenden Geistlichen zu tun, bis sich herausstellte, daß der Gast seinen Einkaufszettel vergessen hatte und die Zutaten für ein asiatisches Rezept leierhaft wiederholte, um ja nichts zu vergessen.
In meiner Wohnung roch es nach faulendem Gemüse, mit silberner Watte überzogene Tomaten lagen auf einem Teller in der Küche. Ein Salatkopf war mit kleinen Fliegen übersät. Ich schmiß alles in eine Einkaufstüte, klebte sie zu und steckte sie in den Müllsack. Noch bevor ich die Post durchschaute oder den Anrufbeantworter abhörte, schenkte ich mir ein Glas Jack Daniels ein. Ein kleines Feuerwerk in der Kehle, bengalisches Leuchten und ein Vulkan im Magen. Ich ging einige Male in dem leeren Zimmer auf und ab, öffnete das Fenster, schloß es wieder und begann, den Koffer auszupacken. Er war gefüllt mit Dingen, die ich für andere Leute mitgebracht hatte. Leibchen, Embleme und eine CD-ROM von und über die Chicago Bulls. Dazu ein Badetuch der Blackhawks, verschiedene Souvenirs, die alle typisch nach Chicago aussahen und deshalb vermutlich auch in Zürich zu kaufen gewesen wären. Zu meinen Einkäufen gehörten auch eine Computerfestplatte und ein digitales Tonbandgerät, das in einem Geschäft an der South Wabbash Avenue verramscht worden war. Es war früher Nachmittag, und der Alkohol schaukelte freundlich in meinem Magen. Die Kopfschmerzen hatten sich hinter die rechte Stirnseite zurückgezogen, ein regelmäßiges Pochen, das aber nicht mehr stärker wurde. Ich packte den Rest aus, setzte mich danach in den Sessel im Wohnzimmer, und schaute mir im Fernsehen die News an. In den zwei Wochen hatte ich nur einige Male die Tribune gelesen und mich über das amerikanische Fernsehen gewundert, in dem eine Person wie Oprah Winfrey zur bestbezahlten Talkmasterin der Welt werden konnte. Eine Antwort fand ich höchstens darin, daß ihre ebenfalls gut bezahlte Konkurrenz noch um einiges unerträglicher war als sie. Über die Schweiz hatte ich nichts gelesen und auch nichts gehört, einmal abgesehen von Meldungen über Martina Hingis, die weltweit Sieg an Sieg reihte.
Die Zeitungen hatte ich abbestellt, zum ersten Mal seit vielen Jahren, ich war zeitungsmüde geworden, schon lange bevor ich meine Kündigung eingereicht hatte. Den Anrufbeantworter ließ ich unangetastet, weil ich mir vorstellte, daß der eine oder andere Arbeitskollege mir ins Gewissen reden wollte. Acht Jahre hatte ich bei der Zeitung gearbeitet, ein braver Inlandredaktor, der sich mit jedem Jahr ein wenig mehr wegschrieb aus seinem Leben, zu einer funktionierenden Einheit wurde, die so gut funktionierte, daß man sie befördern wollte. Doch anstatt die Beförderung zum Ressortleiter anzunehmen, reichte ich meine Kündigung ein. Ich fühlte weder Erleichterung noch bereute ich den Schritt. Einzig der Gedanke, mich noch einmal an meinen Schreibtisch zu setzen und mir selber dabei zuzuhören, wie ich meinen Schritt rechtfertigte, obwohl es nichts zu rechtfertigen gab, einzig dieser Gedanke bereitete mir einen kurzen Schwindel, den ich aber mit drei tiefen Atemzügen wieder verscheuchte. Aber es war noch nicht so weit. Zwei Wochen Chicago, zwei Wochen Zürich, so war es abgemacht. Da ich noch eine Menge Überstunden zu kompensieren hatte, blieben von meiner Kündigungszeit exakt 26 Arbeitstage, die ich noch absitzen mußte.
In der Post fand ich keinen Brief von der Zeitung, was mich beruhigte. Dafür entdeckte ich einen amtlich aussehenden Umschlag, auf den ich mir keinen Reim machen konnte. Er enthielt eine Vorladung der Bezirksanwaltschaft Zürich. Das Datum der Vorladung lag fünf Tage zurück, in dem Schreiben war nicht angegeben, worum es sich handelte. Ich dachte an meinen Wagen, den ich während meiner Abwesenheit bei einer Bekannten in der Garage abgestellt hatte. Ob sie damit gefahren war und einen Unfall verursacht hatte? Oder war er geklaut worden? Ich griff zum Telefonhörer und rief die angegebene Nummer an. Eine Frauenstimme meldete sich, verabschiedete sich wieder, und Musiksirup tropfte aus dem Hörer. Es dauerte lange, bis ich den Bezirksanwalt am Draht hatte. Er forderte mich auf, sofort bei ihm zu erscheinen. Ich fragte ihn nach dem Grund, erhielt jedoch keine Antwort. Er machte mich darauf aufmerksam, daß er mich holen lassen könne, ein Argument, daß ich überzeugend fand. Ich fragte ihn, ob ich vorher noch duschen dürfe. Er sagte bloß, das sei meine Sache. Kein Humor, dachte ich.
3. Miltonduff
Wie immer, wenn ich darum gebeten wurde, pünktlich zu erscheinen, ließ man mich warten. In einem Raum, in dem drei Frauen tippten und telefonierten. Ständig kamen und gingen Leute, einige in Uniform. Ich blätterte in Broschüren, deren Inhalt mich nicht interessierte, versuchte eine der tippenden Frauen aus dem Konzept zu bringen, erntete aber nur einen kurzen Seitenblick. Der Jetlag breitete sich in meinem Körper aus wie billiger Fusel, drückte mir ab und zu die Augen zu. Ich zuckte jedesmal leicht zusammen, wenn ein Sekundenschlaf sein Ende nahm, weil sich wieder eine Tür öffnete, oder ein Telefon klingelte. Ich fühlte mich plötzlich so, als würde ich wieder angeschnallt im Flugzeug sitzen. Softwareprobleme auf dem Nebensitz, leichte Turbulenzen. Die Watte um mich herum wurde dichter, das Geplapper nahm ich wie in einer leichten Narkose wahr. Ein Teil meines Gehirns hatte sich noch nicht damit abgefunden, wieder in Zürich zu sein. Funksignale aus Chicago. Vor dem Amtshaus der Buckingham Fountain, dazu der Duft frischer Bagels. Grotesk übergewichtige Amerikaner, schwarze und weiße, die in engen Shorts ihr Fett über die Straße wuchten. Aufdringliche Händler, die einem keine Minute Zeit lassen, die Waren in den Auslagen anzuschauen. What do you want. Just browsing. Und schon hält dir jemand eine scheußliche Statue unter die Nase. Echt antik und sowieso viel zu billig. Oder war das in Washington? Die Watte wurde löchrig, Zürich, Bezirksanwalt, wie hieß er doch gleich? Beinahe unmerklich schwand die Betriebsamkeit und machte einer ruhigen Feierabendstimmung Platz. Ich saß bereits seit einer Stunde herum und ärgerte mich darüber, kein Buch eingesteckt zu haben, wie ich das sonst immer tat, wenn ich einen Termin bei einem Amt oder einem Arzt hatte. Gerade als ich mich wieder bemerkbar machen wollte, gereizt und müde, rief mich eine der Frauen zu sich. Bezirksanwalt Mülhaupt sei jetzt frei. Mülhaupt, ich wiederholte den Namen einige Male in meinem Kopf. Sie führte mich aus dem großen Büro hinaus, durch einen langen Gang, an Dutzenden von Büros vorbei. Mir kam der Gedanke, daß dies die umgekehrte Form von Halbgefangenschaft war. Während man im Knast die Nacht verbrachte, saß man in den Büros den Tag ab. Redaktionsalltag. Acht Jahre lang. Mir schauderte bei dem Gedanken. Die Frau blieb vor einer der gleichförmigen Türen stehen, klopfte und öffnete die Tür.
"Bitte schön", sagte sie lächelnd und zeigte auf die halboffene Tür. Ich bedankte mich und trat ein. Mülhaupt wusch sich an einem Becken die Hände wie ein Arzt zwischen zwei Konsultationen. Er zeigte auf einen Stuhl, ohne sich vorzustellen oder mir die Hand zu reichen.
"Ich dachte, Sie wollten mich sofort sehen", sagte ich gereizt. Mülhaupt lächelte und setzte sich.
"Ich habe mehr als einen Fall zu bearbeiten", sagte er mit einem kurzen Seitenblick auf einen Stapel Akten.
"Miltonduff" , sagte ich.
"Bitte?" sagte er.
"Nichts. Sie erinnern mich bloß an etwas."
Er zuckte leicht mit den Schultern und suchte nach einer Akte. Der Miltonduff war ein Malt, der früher in einem Kloster gebrannt wurde. Doch nicht das war es, was bei mir Assoziationen weckte. Es war vielmehr Mülhaupts Kopf, seine Gesichtszüge erinnerten mich an die Etikette des Miltonduff. Ein rundes Doppelkinn, die Backenknochen nach unten ausladend, die Wangen leicht eingefallen. Haarbüschel seitlich am Kopf, während die Schädeldecke gelichtet war. Der breite Mund mit den nach oben verlaufenden Winkeln. Nur die Farbe paßte nicht. Die Etikette des Miltonduff war grün mit brauner und weißer Schrift, während Mülhaupt blasses Rosa trug. Er blätterte in den Akten, ich sah Fotos, ohne jedoch zu erkennen, was darauf abgebildet war.
"Sie waren also in Chicago. Darf ich fragen, wann Sie abgereist sind und ob sie die ganze Zeit in Chicago waren?"
"Zwei Wochen Chicago. Heute zurückgekommen. Vielleicht erläutern Sie mir, was ich in der Zwischenzeit verpaßt habe. Mit meinem Wagen scheint alles in Ordnung zu sein, eingebrochen wurde bei mir auch nicht."
"Sie haben einen Anrufbeantworter?"
Ich nickte und wunderte mich. Gab es ein neues Gesetz, das Anrufbeantworter verbot?
"Haben Sie ihn nach ihrer Rückkehr abgehört?"
"Ich bin erst vor ein paar Stunden angekommen, und ich hatte noch keine Lust, mir anzuhören, was andere von mir wollen. Ist das neuerdings ein Delikt?"
"Es gibt keinen Grund, gereizt zu reagieren."
"Es gibt sogar mehrere. Jetlag, ewiges Warten und nebulöse Andeutungen. Kommen Sie bitte auf den Punkt, Herr Mülhaupt."
Er notierte sich etwas und fixierte mich dann mit seinen kleinen Augen.
"Sie sind Journalist? Redaktor bei der Zeitung?"
"Ich habe gekündigt."
"Verstehe."
Ich schüttelte den Kopf und gähnte demonstrativ. Als ich aufstand und einige Schritte machte, wurde Mülhaupt nervös.
"Setzen Sie sich bitte wieder."
"Sagen Sie mir, weshalb Sie mich sprechen wollten, und ich setze mich."
"Sie haben es nicht in der Zeitung gelesen?"
"Was, bitte schön, soll ich in der Zeitung gelesen haben?"
"Susanna Molina."
"Susanna Molina?"
Der Name sagte mir nichts.
"Sie haben die Frau gekannt!"
Langsam dämmerte mir, worauf er hinaus wollte.
"Ist sie tot?"
Molina klang italienisch und rundlich. Susanna klang vertraut. Seltsamerweise fiel mir eine zahnlose Frau ein, die an der West van Buren Street Passanten anschrie, ohne daß sich jemand davon betroffen fühlte. God will punish you. Die Frau sah aus, als wäre sie bereits vor längerer Zeit bestraft worden.
Mülhaupt klopfte mit einem Bleistift auf die Akten, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. Dann schoß ein Bild durch meinen Kopf. Eine Frau mit etwas fahrigen Bewegungen und einer Zigarette im Mundwinkel. Sue. Ich hatte völlig vergessen, daß sie mit Nachnamen Molina hieß. Mülhaupt schien zu registrieren, daß die Erkenntnis Schweißperlen auf meine Oberlippe zauberte. Er hielt mir ein Foto hin. Ich setzte mich wieder und schaute mir das Foto an. Ich zuckte unwillkürlich zusammen, stellte aber beruhigt fest, daß es kein Leichenfoto war, es zeigte Sue, als sie noch lebte.
"Sie wurde vor einer Woche ermordet aufgefunden."
Das war am Samstag, als ich mit der EL vom Loop über den Kennedy Expressway ins Greektown fuhr. An der South Halsted aß ich Tzaziki und hörte griechische Gesänge.
"Sie haben die Tote gut gekannt?" Er lächelte leicht, was ihn mir nicht sympathischer machte. Sue zieht sich aus und kriecht unter die Decke wie ein scheues Schulmädchen. Alles Koketterie, verlegenes Lächeln, festkrallen, und dann zieht sie mich tief in sich hinein. Hatte sie den Tod auch in sich hineingezogen oder kam er als ungebetener Gast? Mülhaupt räusperte sich. Sue ist jetzt angezogen und erzählt von einer Abtreibung.
"Ich habe über ein Jahr nichts mehr von ihr gehört. Ich habe Sie nicht gut gekannt, wir sind uns heftig begegnet und haben uns sehr schnell wieder von einander abgewandt."
"Sie hatten eine Beziehung mit ihr?"
"Ein Wochenende, mehr nicht. Ich verstehe nicht, weshalb Sie überhaupt auf mich gekommen sind. Haben Sie ihr Tagebuch gelesen?"
"Soweit wir feststellen konnten, hat sie kein Tagebuch geführt."
"Steht mein Name in ihrem Notizbuch?"
Mülhaupt zog eine eng beschriebene Seite aus einem Umschlag und las schweigend einige Zeilen, ehe er wieder zu mir hoch blickte.
"Frau Molina wurde in der Nacht zum Samstag ermordet, vermutlich kurz nach Mitternacht. Ihre Leiche wurde um 8 Uhr aufgefunden. Die Rekonstruktion der letzten Stunden im Leben von Frau Molina hat ergeben, daß zwischen 21 Uhr und Mitternacht eine Lücke besteht. Vorher war sie zu Hause. Um 19.45 Uhr rief sie von ihrer Wohnung aus eine Freundin an, mit der sie sich für den darauffolgenden Tag zu einem Kinobesuch verabredete. Etwa um 21 Uhr verließ sie die Wohnung, fuhr mit ihrem Wagen weg, ohne daß wir wissen, wohin sie fuhr und mit welcher Absicht sie unterwegs war. Wir wissen nur, daß sie kurz vor Verlassen der Wohnung ihr Telefon benutzte. Sie hat diese Nummer hier angerufen."
Er hielt mir einen Zettel hin, auf dem meine eigene Telefonnummer stand. Das also war es. Die Nachricht einer Toten. Ich holte mein Handy aus der Tasche und wählte meine Nummer. Mülhaupt winkte ab.
"Sie hat keine Mitteilung hinterlassen."
Ich schaltete das Handy wieder aus und schaute ihn verblüfft an.
"Woher wissen Sie das?"
"Da wir Sie nicht erreichen konnten, sind wir aktiv geworden."
"Sie waren in meiner Wohnung?"
Mülhaupt grinste.
"Wir haben unsere Spezialisten. Die Nummerncodes vieler Anrufbeantworter sind relativ simpel."
"Ist das legal?" fragte ich.
"Angesichts der Sachlage hätte nichts gegen eine Wohnungsdurchsuchung gesprochen. Das Abhören des Anrufbeantworter schien mir das kleinere Übel zu sein, zumal ich davon ausgegangen bin, daß Sie während der Tatzeit tatsächlich nicht in Zürich waren."
"Ohne dieses Alibi wäre ich jetzt ihr Hauptverdächtiger?"
"Weshalb hat Frau Molina Sie angerufen?"
Darauf hatte ich keine Antwort. Sue hatte sich nie mehr bei mir gemeldet. Weshalb sollte sie es ausgerechnet an ihrem letzten Abend tun? Sie liegt wieder unter der Decke und flüstert mir zu, daß sie manchmal Angst davor hat, alt und einsam zu sterben. Sues Büchergestell bricht unter dem Gewicht von in Buchdeckeln gepresster Verzweiflung beinahe zusammen. Romane, Novellen, Tagebücher voller Lebenskrisen und Existenzängste.
"Vielleicht hat sie sich verwählt."
Mülhaupt lächelte. Ich kam mir dämlich vor, weil ich unüberlegt geantwortet hatte. Auf der Hut sein, hier und überall. Südlich der North New Orleans eilte ich durch den Regen. Feindselige Blicke, jugendliche Schwarze in Gruppen. Einmal glaubte ich ein Klappmesser aufblitzen zu sehen. Noch einmal davongekommen, dachte ich, als ich wieder in der EL saß, die weiter Richtung Süden zum Oak Park fuhr. Ausflugsziel, putzige Häuser des Architekten Frank Lloyd Wright. Unter mir das Elend der Schwarzenghettos. Zerfallene Häuser, Fabriken ohne Fensterscheiben wie Köpfe ohne Augen.
"Ich weiß schon", sagte ich. "Wenn sie sich verwählt hat, weshalb hat sie dann nicht noch eine andere Nummer gewählt?".
Mülhaupt, machte sich Notizen und nickte.
"Ihre Nummer war als letzter Anruf auf ihrem Apparat gespeichert. Sie hat vermutlich kurz danach das Haus verlassen. Kann es sein, daß sie etwas bei Ihnen abholen wollte?"
Ich schüttelte den Kopf.
"Ich war nur zwei Tage bei ihr. Sie war nie in meiner Wohnung, und wir haben uns nichts geschenkt. Ich habe, wie ich schon sagte, über ein Jahr lang nichts mehr von ihr gehört, sie auch nicht zufällig getroffen."
"Seltsam", sagte Mülhaupt leise.
Natürlich, dachte ich. Seltsam ist es, aber was geht es mich an? Sue hält die Kaffeetasse in beiden Händen, bläst sanft ihren Atem auf den heißen Kaffee. Du liebst eine andere, sagt sie und ich schweige, weil sie recht hat. Drei Monate später kam ich zufällig an der Straße vorbei, in der sie wohnte. Ich klingelte, sie war nicht zu Hause oder öffnete nicht. Ich brauche dich jetzt, Sue. Am nächsten Morgen erwachte ich mit heftigen Kopfschmerzen.
Mülhaupt befragte mich zu meinen persönlichen Lebensumständen, wie er es nannte. Single, aber nicht allein, sagte ich. Arbeitslos, aber nicht ohne Arbeit. Keine Perspektiven, aber nicht hoffnungslos.
"Ich kann jederzeit wieder als Journalist einsteigen. Aber ich hoffe, daß ich nicht dazu gezwungen werde, es zu tun."
"Was gedenken Sie künftig zu arbeiten?"
"Macht es mich verdächtig, wenn ich gedenke, diese Frage nicht zu beantworten?"
Mülhaupt kratzte sich an der Nasenspitze. Sue hält mir ein Foto hin. Ein Liebespaar vor einem zerbombten Haus. Es ist jederzeit alles möglich, sagt sie. Ihre Leiche wurde um 8 Uhr aufgefunden. 1 Uhr früh in Chicago. Saß ich an einer Bartheke und trank einen Wild Turkey? Mülhaupt sagte, ich könne jederzeit anrufen, wenn mir etwas einfalle, egal was. Jedes Detail ist wichtig, dachte ich. Der Tod drang in meinen Kopf. Sue lächelte nicht mehr. Chicago war jetzt eine Stadt am Lake Michigan und Zürich war Sues Grab. Sue fröstelt, als wir es auf dem Fußboden machen. Ich friere oft, sagt sie, egal wie warm es draußen ist.
4. Ardmore
Ich verbrachte mehrere Stunden damit, auf dem Anrufbeantworter nach Sues Anruf zu suchen. Es waren zwölf Mitteilungen gespeichert und neunmal vernahm ich das typische Knacken, das man hörte, wenn jemand einhängte, ohne etwas auf das Band zu sprechen. Mit einem digitalen Anschluß hätte ich jeden Anruf zuordnen können. So aber hörte ich mich durch die Tage, rief bei Freunden und Bekannten an, fragte, wann sie auf mein Gerät gesprochen hatten, und kam so dem Knacken immer näher, jenem Knacken, das Sue hinterlassen hatte. Schließlich blieb nur noch ein Anruf übrig. Ich hörte ihn mir immer wieder an, ließ die Kassette zurückspulen, steckte sie in einen großen Radiorecorder, auf dem die Stimmen der Anrufer ganz natürlich klangen, während auf dem Anrufbeantworter alles ein wenig schäbig und schrill durch den Lautsprecher kam. Ich setzte einen Kopfhörer auf, um das Knacken besser hören zu können. Sie hatte ein, zwei Sekunden gewartet, so als überlegte sie sich, doch etwas aufs Band zu sprechen. Aber dann legte sie den Hörer wieder auf die Gabel. Letzter Anruf, danach bist du tot.
Ich saß da und konnte es nicht fassen. Ermordet, sagte ich mir immer wieder. Ich sah Sues Gesicht, ihren fragenden Blick, der einer entsetzlichen Angst wich. Eine Fratze nur noch, eingeprägt aus Dutzenden von Horrorfilmen. Der Tod war ein Film mit Darstellern, die jederzeit wieder aufstehen konnten, um sich für den nächsten Dreh frisch zu machen. Doch für Sue gab es keine neuen Szenen mehr, keinen neuen Film.
Der Tod drang nicht zum ersten Mal in mein Leben. Mein jüngerer Bruder hatte sich aus Liebeskummer das Leben genommen, meine Mutter war an Krebs gestorben und ein Freund betrunken mit seinem Wagen in eine Hausmauer gedonnert. Wer lange lebt, stirbt viele Tode.
Ich las die Zeitungen, die ich mir besorgt hatte, Satz für Satz, alles über die Leiche, den Mord, die Umstände. Worthülsen, wie sie meine Kollegen produzierten, Sätze wie Textbausteine, achtlos kopiert für die nächste Müllabfuhr. Die Polizei und Bezirksanwalt Mülhaupt waren ratlos. Sue war nicht vergewaltigt worden, vermutlich auch nicht beraubt, kein Motiv in ganz Zürich, nur eine Tote, von der niemand wußte, weshalb sie mich anrief in jener Nacht, als sie noch lebte, ganz kurz. Klarer Himmel, 12 Grad, Mond und Sterne und Sue mit einem Messer im Bauch. Ihr Wagen wurde in der Nähe des Albisriederplatzes gefunden, weit weg, 30 Minuten mindestens zu Fuß. Niemand hatte gesehen, wie sie ausstieg, niemand, wohin sie ging. Nachtstimmung im Industriegebiet. Schlafende Fabriken, und auf die Straße tropft Blut. Wo war sie geblieben, jene Nacht mit Sue, als ich sie zum ersten Mal traf, zufällig wie der Strahl einer Taschenlampe?
Laute Musik wummerte durch den Raum, eine Gitarre heulte und ein Schlagzeug stampfte wie eine Maschine durch die Bar. Neben mir saß Conny, das dritte Glas Champagner in der Hand, Augen wie Diamanten, die den Raum durchschnitten. Keine Zeit für Flirts, nur ein kurzes Abtauchen in die Sünde. Conny erzählte vom Sportjournalisten, der scharf auf sie war und in seine Reportagen griechische Götter und lächerliche Sprachbilder einflocht, um sie zu beeindrucken. Wöchentlich ein Kommentar, hier eine Trainerschelte, da ein Rat an einen Sportverband und natürlich permanent Analysen, die schon am nächsten Tag nichts mehr taugten.
"Ich hasse Sportjournalisten", schrie Conny in den verrauchten Raum.
"Er rechtfertigt sich dauernd. Sagt, daß er nur als Sportjournalist die Möglichkeit habe zu reisen, an olympische Spiele zu fahren oder sich an einer Weltmeisterschaft mit Hamburgern vollzustopfen. Schön und gut, aber wie intelligent kann ein Mann sein, der sich täglich mit unterbelichteten Sportlern abgibt, ohne dabei an Selbstmord zu denken? Ich denke fast täglich an Selbstmord, und dabei habe ich es nur mit unterbelichteten Politikern zu tun."
Conny hatte sich in fünf Jahren von der freien Lokaljournalistin zur anerkannten Politredakteurin hochgeschrieben. In ihrem Leben hatte die Zeitung alles andere verdrängt. Ihren Mann, ihren Hund, den sie ihrer Schwester schenkte, und ein behagliches Leben in einer linken Wohngemeinschaft mit braven Lehrern und einer Umweltaktivistin, die davon träumte im Rahmen einer Greenpeace-Aktion irgendwo angekettet zu werden. Conny hatte alles abgestreift wie Kleider, die sie zu lange getragen hatte. Nur ihre Tochter behielt sie, eine sechsjährige Diktatorin, die mit Gummihämmern auf Gäste einschlug und mit dem Löffel Teller zertrümmerte, auf denen nicht das lag, worauf sie Lust hatte. Conny zog in eine teure Wohnung, kaufte sich Designerklamotten und rätselte bei einer Flasche exquisitem Rotwein gerne darüber, weshalb nur bürgerliche Politiker erotisch auf sie wirkten.
Conny ging nicht oft in die Bar, die hauptsächlich von Medienleuten besucht wurde. Ich war eine Weile Stammgast, was zur Folge hatte, daß Kevin, der den Laden schmiß, immer mehrere Flaschen Maltwhisky vorrätig hatte. Als Sue in mein Scheinwerferlicht trat, stand ich an der Bar und nippte an einem Glas Ardmore, eine Premiere, da dieser Malt nur schwer erhältlich war zu jener Zeit. Sue kam auf uns zu und begrüßte Conny mit Wangenkuß. Conny stellte uns vor, doch im Lärm ging mein Name unter, Sue fragte mich erst danach, als wir schon in ihrem Bett lagen, daunenweich und umweht von Rosen, die aus einer Duftlampe dampften.
Conny schaltete auf theatralische Gesten um, was sie oft tat, wenn sie mit anderen Frauen sprach. Wie geht es, was machst du, how's your lovelife, all den Müll, der uns daran hindern soll, miteinander zu reden. Sue hatte keine Lust, über sich zu reden, verlegenes Lächeln, wenn sich unsere Blicke trafen, der schweigende Whiskytrinker und seine Zuversicht für eine Nacht.
Tot, tot, tot. Der Schrecken eines Computerspiels, in dem unvermittelt ein Feind auftauchte und schneller ist. Game over, wenn man Glück hatte, reichte es für die Highscoreliste. In welcher Tabelle tauchte Sue auf nach ihrem Tod? Ungeklärte Verbrechen, wir bitten um ihre Mithilfe. Ich stellte mir einen Abend vor, der sich hinzog wie ein Arztbesuch. Sue in ihrer Wohnung, eingeschlossen zwischen Kühlschrank und Kabelfernsehen. Wen anrufen, um das Gespenst der Einsamkeit zu vertreiben? Kommst du, willst du, möchtest du, die erniedrigende Suche nach einer Ausflucht. Schließlich der Griff zum Telefonhörer, sich räuspern, tief Luft holen und insgeheim der Wunsch, es möge niemand da sein. Fernes Tuten, ehe der Anrufbeantworter in die Leitung knackt. Keine Worte, nur eine Sekunde der Unsicherheit. Jetzt nichts wie raus in den Wagen, weg, wohin auch immer. Hatte es in Chicago geklingelt in meinem Ohr? Wenn jemand intensiv an dich denkt, klingelt es in deinem Ohr, sagte mein Großvater immer. Nenn mir einen Buchstaben, sagte er, und dann suchte er in seiner Erinnerung nach Namen, und manchmal lächelte er zufrieden, weil er zu wissen glaubte, wer in seinem Ohr angerufen hatte. Wenn ein Buchstabe zu keinem der gespeicherten Namen paßte, blieb er verstört sitzen. Falsch verbunden, sagte er dann nach einer Weile, doch sein Lächeln war ängstlich. Glaubte er, daß der Tod auch im Ohr klingelt, um seinen bevorstehenden Besuch anzukündigen? Ich habe ihn nie danach gefragt, auch nicht, weshalb er nach Großmutters Tod den alten schweren Telefonapparat durch einen neuen ersetzte.
Kein Klingeln in Chicago, auch sonst kein Zeichen, keine plötzliche Erinnerung. Ein Traum nur, in dem Conny auftauchte, auf Rollerblades durch den Grant Park fuhr und doch immer auf gleicher Höhe mit mir blieb. Die lebende Sue hatte sich nicht mehr in mein Bewußtsein geschlichen, erst die tote Sue verlangte nach neuer Aufmerksamkeit.
Das Band lief und lief, ich kopierte es, aus Angst davor, die Stelle irrtümlich zu löschen. Warum nur wurden Gedanken nicht gespeichert wie Worte, die man sprach? Sue in ihrer Wohnung, im Schneidersitz, das Telefon auf dem Schoß. Sonntagnachmittag, es wird Zeit für mich zu gehen. Schon gut, sagt sie. Keine Worte zum Abschied, zwei Routiniers am Tag danach. Hast du nichts vergessen? Ich fahre morgen für ein paar Tage nach Italien. Beneidenswert. Erleichterung, als die Tür zugeht. Keine schlechten Gedanken, keine Reue, abgehakt, ein Wochenende in einer fremden Wohnung, einem fremden Körper. Zwei Seelen, die sich berühren und wieder voneinander entfernen. Ein paar Tage später erkundigte sich Conny, verschmitzt und argwöhnisch zugleich. Sue ist nicht einfach, einmal bist du ihr nah und dann wieder fern, sagte sie. Ich hatte mich in Conny verliebt, aber ich sprach mit ihr nicht darüber. Auch später nicht, als ich Connys Geliebter wurde, dann, wenn sie Lust hatte und ihre Tochter nicht da war. Hast du dich in Sue verknallt, fragte sie, und ich lachte und kam mir gemein vor, weil sich das Lachen gegen Sue richtete und es weh tat.
Conny trank ein viertes Glas und lachte laut über Dinge, die nicht komisch waren. Sue lachte nicht mit, sie blieb auch nach dem zweiten Glas Rotwein ernst, ihre Augenlider flatterten, wenn sie einen Punkt in der Bar zu fixieren versuchte. Hastige Züge an einer Zigarette. Ein bärtiger Mann, der aus dem Mund stank, stellte sich vor Conny hin und schaute sie fragend an. Es dauerte eine Weile, bis sich Conny an ihn erinnerte. Die beiden unterhielten sich, und ich spürte, wie Sues Ellbogen meine Hüfte streifte. Sie lächelte, wandte sich aber sogleich wieder ab. Der Bärtige erzählte Conny, er werde zu einer Wochenzeitschrift wechseln. Man habe ihn angefragt, sagte er stolz. Es gibt viel zu viele Zeitschriften in diesem Land, sagte Conny und drehte ihren Kopf weg, vermutlich, um dem schlechten Atem des Bärtigen auszuweichen. Sue ging plötzlich weg, schaute sich aber nach mir um, als sie Richtung Toilette verschwand. Conny und der Bärtige tauschten Tratsch über Kollegen aus. Es kamen immer mehr Leute in die Bar, es wurde eng, eine Lederjacke rieb sich an meiner Schulter, ein Kerl wie ein Baum, glatzköpfig, bestellte sich ein Bier. Drei grinsende Schreiberlinge eines Nachrichtenmagazins versperrten mir den Blick zur Toilette. Ich machte mich breit und drückte einer Frau meinen Ellbogen in den Rücken. Sie wich zur Seite, ohne sich nach mir umzudrehen. Es wurde unerträglich, und Conny freute sich. Ihr gefiel es, andere Körper zu spüren, doch der Gestank des Bärtigen schien sie zu nerven. Sie schaute ihm kaum noch ins Gesicht, redete an ihm vorbei, schnappte nach Luft, wenn er sprach. Sie kam mir jämmerlich vor in ihren Bemühungen. Weshalb sagte sie dem Kerl nicht, daß er stank? Weshalb sagte ich mir nicht, daß es mich ankotzte unter all meinen Kollegen? Sue erschien nicht mehr, mein Glas war leer, und ich hatte keine Lust, noch etwas zu bestellen. Der Bärtige war plötzlich weg, Conny grinste mir zu, schaute sich gleichzeitig nach anderen Leuten um und war schon Sekunden später wieder in ein Gespräch vertieft. Zwischendurch stoppte die Musik und die lauten Stimmen wirkten seltsam fremd und deplaziert. Es gelang mir, mich zu lösen, die Bar zu verlassen. Auch draußen standen Leute herum und tranken. Sue unterhielt sich mit einem Mann mit langem strähnigem Haar. Ein fahler Mond illustrierte die Szene. Sie ist schön, dachte ich plötzlich, und starrte neidisch auf den Mann, dessen rechte Hand auf Sues Schulter ruhte.
Alle Rechte beim Autor, Nachdruck und Veröffentlichung sind nicht erlaubt.